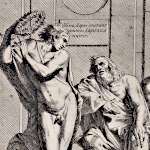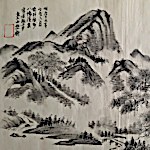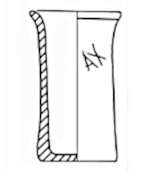Jacques Lacan
Seminar IX, Die Identifizierung
(XIII) Sitzung vom 14. März 1962
Übersetzt und mit erläuternden Anmerkungen versehen von Max Kleiner und Rolf Nemitz
 „Diese mögliche Abhängigkeit der beiden Topologien, der des einen Torus von der des anderen, drückt letztlich nichts anderes aus als das, was das Ziel unseres Schemas ist, insofern wir es durch den Torus stützen lassen.“
„Diese mögliche Abhängigkeit der beiden Topologien, der des einen Torus von der des anderen, drückt letztlich nichts anderes aus als das, was das Ziel unseres Schemas ist, insofern wir es durch den Torus stützen lassen.“